Social Spots. Filme über Hilfsprojekte weltweit.
Der besondere Blick.
Ich finde, jede Geschichte sollte mit den bestmöglichen Bildern erzählt werden.
Das heisst: Überall das spannendste, eindrucksvollste Bild zu suchen. Nicht irgendwie draufhalten, nur weil die Umstände schwierig sind, man sich nicht sicher fühlt oder schnell wieder weg will. Das ist für bestimmte Formate in Ordnung, aber ich möchte so nicht arbeiten.
Im letzten Flüchtlingslager, unter den widrigsten Umständen, kann man sich entscheiden, die richtige Perspektive, den spannenden Blickwinkel zu suchen. Vorder- und Hintergrund auswählen. Einen Reflektor benutzen. Ruhe reinbringen. Ein Stativ, eine Hose, Schuhe, kann man waschen; eine Kamera putzen. Und wenn unsere Protagonisten im Dreck leben, drehen wir eben auch im Dreck. Und machen uns schmutzig.
Das geht nur mit Kameraleuten und Kollegen, die eine ähnliche Leidenschaft für Bilder, Menschen und besondere Momente haben. Wer nicht leidensfähig ist – bei 40 Grad im Dschungel zu schwitzen und nicht genau zu wissen, was der Matsch ist, in den man sich gerade reinkniet, der hat bei so einem Dreh nichts verloren…


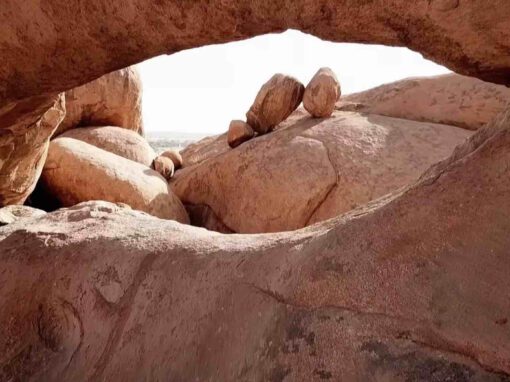




















WIE WIR ARBEITEN
Der besondere Moment, ein starkes Bild entsteht durch Nähe, Vertrauen, Zeit.
Am besten lernen wir unsere Protagonisten erst mal ohne Kamera kennen. Damit sie uns als Menschen sehen – und nicht durch die fremde Technik verunsichert sind.
Durch Nähe entsteht Intensität. Selbstverständlich haben wir schon verdeckt oder heimlich gedreht, z.B. Soldaten, Checkpoints oder kritische Situationen.
Aber besondere Bilder bekomme ich, wenn ich offen agiere und mich den Menschen zeige. Manchmal reicht ein Lächeln oder ein Nicken des Einverständnisses, manchmal gibt es ein ausführliches Gespräch. Aber die schönsten Momente entstehen dann, wenn die Menschen uns kennen, sich an die Kamera gewöhnt haben. Wir verändern das Bild, aber wenn wir den Menschen vertraut sind, werden sie sich erstaunlich schnell wieder natürlich verhalten. Das geht aber nur, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt.
Diese Freiheit kann ich mir erlauben, wenn ich selbst produziere. Wenn das Budget nicht von festbezahlten Redakteuren, Produktionsleitern oder schicken Produktionsfirmen aufgefressen wird.
Das muss nicht mehr kosten, aber wir gehen mit der Zeit anders / effektiver um. Eigenes Equipment gibt mir beim Drehen und in der Postproduktion die Freiheit, so lange an einem Projekt zu arbeiten, bis es meiner Meinung nach passt und fertig ist. Nicht, wenn das Budget erschöpft ist.
Manchmal sind wir gestresst: Weil die Sonne weggeht. Regen kommt. Wir noch vor der Dunkelheit wegmüssen. Es nicht sicher ist. Die Akkus alle sind. Der Flieger geht. Jemand krank ist. Wir noch 2 Stunden bis zum nächsten Dorf fahren müssen. Das Wasser zu hoch steht und wir nicht über den Fluss kommen.
Trotzdem ist klar: Hektik hat noch keine Geschichte besser gemacht. Daher nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen – und bauen einen Puffer ein.
Manchmal geht es nicht anders. Dann kommt es mir so vor, dass die stärksten Bilder immer da sind, wo die Kamera gerade nicht hinschaut. Wie es mal ein Kollege am grossen Spielfilmset so treffend formuliert hat.
In der Nähe sein, bedeutet: Lieber im Zelt oder unter freiem Himmel schlafen, als zwei Stunden vom Hotel zu den Menschen in die Dörfer / Wüste / den Busch zu fahren.
Gerade in der früh, wenn zum Sonnenaufgang alle aufstehen, wenn das Dorf aufwacht, gibt es die intensivsten Momente: Unverstellt, natürlich, verschlafen. Und natürlich das schönste Licht. Wie bei den Afar in der äthiopischen Wüste: Wir haben ganz in der Nähe vom Dorf draussen geschlafen. Mein Kameramann und ich sind als erste auf. Die Kinder aus dem Dorf kennen uns schon, haben keine Scheu. Sie können uns nicht verstehen. Aber sie nehmen uns mit Kamera einfach mit. Zum Wasser holen, Ziegen füttern und Brot backen. So entstehen einmalige Bilder. Das hätten wir mit Dolmetscher, Begleiter, etc. so nie bekommen.
Von Zivilisten / Fremden sind wir bisher nur in Haiti mit Kamera bedroht, beschimpft und angegriffen worden. Wenn man sich offen, selbstverständlich und freundlich zeigt und vorstellt, bekommt man fast immer ein positives, freundliches Feedback. In Baghdad genauso wie in Kabul am Markt oder in der einsamsten Steppe in der Mongolei. Nicht jeder will vor die Kamera, aber das ist selbstverständlich.
Sobald die Menschen uns kennen, fühlen sie sich meist für uns mit verantwortlich. Weil wir ihre Gäste sind. Und weil ihnen unsere Arbeit sinnvoll vorkommt.
Schwieriger ist es manchmal auf langen, einsamen Fahrten in Krisenregionen. Da fallen wir als Ausländer sehr auf, und in Ländern wie dem Tschad gibt es grosse Sorge vor Entführungen. Das betrifft v.a. Entwicklungshelfer und Journalisten.
Hier ist es entscheidend, mit wem man vor Ort zusammenarbeitet. Diese Partner müssen zu 100% zuverlässig sein und wissen, was sie tun. Und wir müssen ihnen vertrauen, dass ihre Einschätzung stimmt.
in Kolumbien wurden wir von Anwohnern gewarnt, als uns jemand ausrauben wollte. In der Favela in Rio haben die Menschen dort auf uns aufgepasst. Und selbst in Sad‘r City in Baghdad 2003 – wo es später die meisten Anschläge gab – konnten wir uns frei bewegen. Wir waren Gäste des lokalen Scheichs, auch wenn wir ihn nie getroffen haben. Er wusste, dass wir da sind und hatte das akzeptiert. Damit waren die Regeln klar.
Auf den Philippinen mussten wir letztes Jahr mit Polizeischutz drehen. Einer unserer Protagonisten ist nachts in seiner Hütte beschossen worden. Da ging es um eine lokale Mafia, welche die Arbeit unserer Partner verhindern wollen. Aber wir waren kein Ziel.
